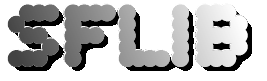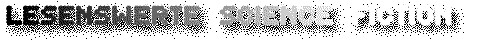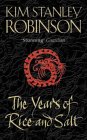
The Years of Rice and Salt: Ein Geschichtsbuch. Ein Geflecht, bunt schillernd. Verwirrend viele Fäden. In den nüchternen Begriffen, wie sie für die Rezension von Science-Fiction verwendet werden: Alternate History, ausgehend von der Frage: »Was wäre, wenn Europa (und damit auch das Christentum, jedenfalls als wichtige Religion) im 14. Jahrhundert unserer Zeitrechnung von der Pest befallen worden wäre, um im Westen des Eurasischen Kontinents nur Leere und verfallende Kathedralen zu hinterlassen?« Der Bogen spannt sich über 600 Jahre, die Perspektiven wechseln genauso wie die immer wieder re-inkarnierten Charaktere B., K., I. und S.: die Goldenen Horden, das Indien der Mugal-Herrscher, das vom Islam wiederbesiedelte Frankien, China, China, die Neue Welt, Tibet, Samarkand, etc. Die Weltkarten im Buch drehen und verschieben sich, die großen Religionen bleiben im großen und ganzen die gleichen - nur eben abzüglich des Christentums.
Aber ganz so einfach ist es nicht. Das Geflecht schillert, viele Fäden sind verwoben, und nicht nur, weil es eben um ganz unterschiedliche Kulturen, Religionen und Orte geht. Kim Stanley Robinson flechtet auf den über 700 Seiten auch ganz unterschiedliche Fäden auf einer höheren Ebene zusammen:
Da sind islamische (persische, arabische), chinesische, indische, indianische, ... Erzählstile, Traditionen und Sichtweisen, zeitgebunden - es gibt unglaublich viel zu lernen, und nicht immer ist klar, wieweit »This novel is entirely a work of fiction« nun tatsächlich gilt. Ob die Beschreibung der islamischen Renaissance und ihrer Alchemisten nicht doch so ähnlich verlaufen sein könnte. Ob die Bürokratien der Qing- Dynastie so bürokratisch waren, wie Robinson sie darstellt. Ob die Besiedlung Lateinamerikas nicht tatsächlich ostasiatischen Ursprungs sein könnte. Die Grenzen zwischen dem, was wirklich war, und dem, was hätte sein können, verschwimmen in okzidentaler Unwissenheit.
Da ist aber auch die Geschichte der Welt von 1400 bis heute, unserer Welt: nur etwas verschoben. Die Kriege (bis him zum ersten und zweiten Weltkrieg mit dem Schrecken mechanischer Kriegsführung, die hier zu einem »Long War« verschmelzen, der vielleicht noch um einiges schrecklicher ausfällt). Die Politik. Die Wissenschaft. Renaissance- Gedanken. Gedanken der frühen Moderne. Moderne Entwicklungen. Der ständige Widerstreit zwischen Mystizismus und Moderne. Oder, anderswo: Die asiatischen Tigerstaaten mit hundertstöckigen Hochhäusern. Luftschiffe. Taylorismus im indischen Bund. Die Wiederentdeckung fränkischer Musik (mit ihrem seltsamen System, Noten genau festzuschreiben). Die chinesische Revolution der Arbeiter und Bauern, aber dann doch eine andere. Umweltprobleme, Globalismus.
Neben diesen beiden Ähnlichkeiten mit der tatsächlichen Geschichte - der »echten Ähnlichkeit« und der »verschobenen Ähnlichkeit« spielt Robinson auch mit echten Unterschieden. Am auffallendsten natürlich das islamisch gewordene Europa, Franjistan (oben auf den Orkney-Inseln haben ein paar Kelten überlebt, Ureinwohner). Die Indianer der großen Seen in Nordamerika sind erfolgreich im Widerstand gegen fränkische wie ostasiatische Besatzer, werden zusammen mit der japanischen Diaspora und Südindien zum Zentrum der modernen Zivilisation.
Der vierte Faden ist vielleicht Robinsons politisches Programm: Der Mars kommt zur Erde, und wir finden immer wieder Feminismus, Humanismus, Religiösität ohne Götter, Gleichheit aller Menschen, Lehren über die Akkumulation von Eigentum - ein politisches, utopisches Programm, wie es nicht nur in der Mars-Büchern, sondern auch in der Kalifornien-Trilogie durchscheint. In diesem Sinne - und mit einem sehr selbstreflexiven Ende - ist The Years of Rice and Salt auch eine globale Utopie. Und zugleich, wie alle guten neueren Utopien, ein überaus realistisches und pragmatisches Buch, das von Fehlschlägen und Irrtümern, ja: von der menschlichen Natur weiss.
Fünftes spielerische Verzirrungen: im Stil der Texte, in absurden Verweisen auf heutiges, in den dazwischengeschobenen Treffen im Bardo, der Zwischenstation der Re-Inkarnation.
Ein Buch mit sehr viel Sympathie und Empathie, für andere Denksysteme, für den islamischen Grundgedanken der Gleichheit (vor Gott), für Buddhismus, Taoismus, Hinduismus, insgesamt auch für das Zusammentreffen und sich Mischen von Gedanken und Kulturen - nicht nur in Bezug auf Religionen (muslimische Chinesen, die Sikhs, ein Samurai bringt dem indianischen Bund bei, sich zu verteidigen, tibetische Mathematiker beim Alchemisten des Kalifen).
Siebtens: Echte Science-Fiction, weil es auch ein Buch über Wissenschaft ist: über den wissenschaftlichen Fortschritt, über das Sich-aufeinander-beziehen in einer sehr lange schon globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft, aber auch über den täglichen Ablauf wissenschaftlicher Arbeit im Wandel der Zeiten - Texte, Gedankenaustausch, Experimente, Lehre, Konferenzen
Und schließlich: In gewisser Weise ein Lehrbuch, das nicht lehren will und gerade dadurch lehrt. Wer möchte, kann hier sehr viel mehr lesen, als geschrieben ist, sich Gedanken machen: aus Kunst wird irgendwie Wissenschaft, wird Politik, ein auf einem Fundament aus abgewogenen und diskutierten Ideen - über Geschichte, über Fortschritt, über Kulturen, über das menschliche Leben - stehendes Programm.
Was wird eingefangen mit diesem Geflecht, diesem Netz? »What's hardest to catch is daily life« (S. 768), wenn es darum geht, Geschichte zu schreiben - vielleicht gar nicht so alternativ, wie es auf den ersten Blick aussieht, und vielleicht um einiges alternativer gedacht, als es auf den ersten Blick aussieht. Kim Stanley Robinson jedenfalls ist das mit diesem Buch Zeiten- und Kulturen überspannend gelungen.